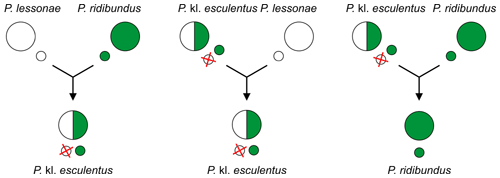Die Erdkröte gehört zu den häufigsten Ampibien in Dortmund, wohl auch, weil sie durch ihre rege Wandertätigkeit im Frühjahr am meisten auffällt. Nach der Winterstarre machen sich die Tiere sobald es warm wird, auf ihre Wanderung zum Laichgewässer. Dabei queren sie Straßen und begeben sich somit in Lebensgefahr. Erdkröten legen Eierschnüre unter Wasser ab. Nach der Eiablage wandern die Tiere in ihren Landlebensraum (Wald, Waldrand, Heckensäume…) und verbringen hier den Rest des Sommers.
Ordnung: Froschlurche (Anura)
Unterordnung: Moderne Froschlurche (Neobatrachia)
Familie: Kröten (Bufonidae)
Gattung: Echte Kröten (Bufo)
Art: Erdkröte (Bufo bufo – L. 1758)
Lebensraum: Fast alle Lebensräume Mitteleuropas, von Meeresspiegelhöhe bis ins Hochgebirge, bei einer Bevorzugung von Wäldern (Laubwälder, Mischwälder).
Laichgewässer: Vorwiegend größere stehende und tiefere Gewässer, z.B. Weiher, Teiche (einschließlich Fischteiche) und Seen.
Laich: 3000 – 8000 schwarze Eier, in 2 – 4 Reihen angeordnet, finden sich in 3 – 5 m langen Laichschnüren, die Straff um vertikale Strukturen (Pflanzen, Äste) gewickelt werden.
Nahrung: Vor allem Ameisen und Käfer, daneben Regenwürmer, Spinnen, Tausendfüßer und Landschnecken.